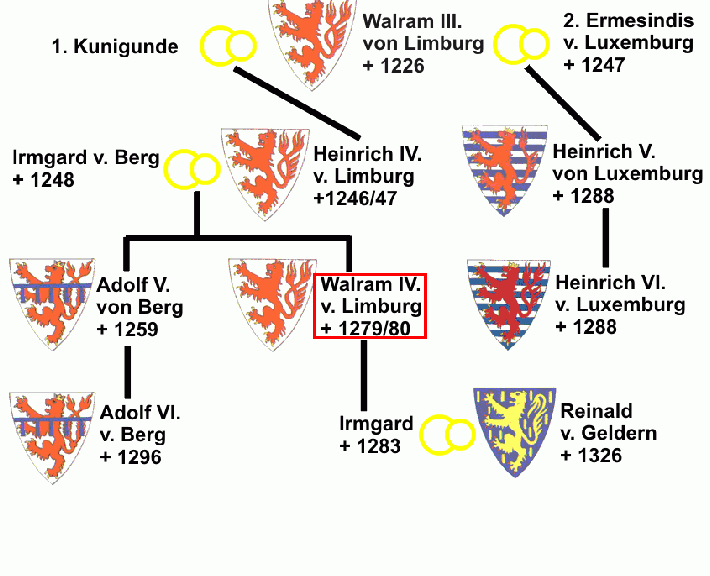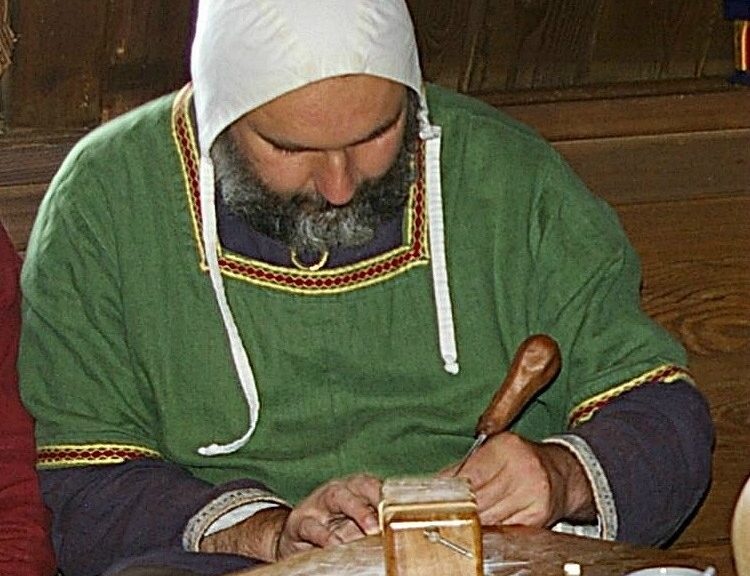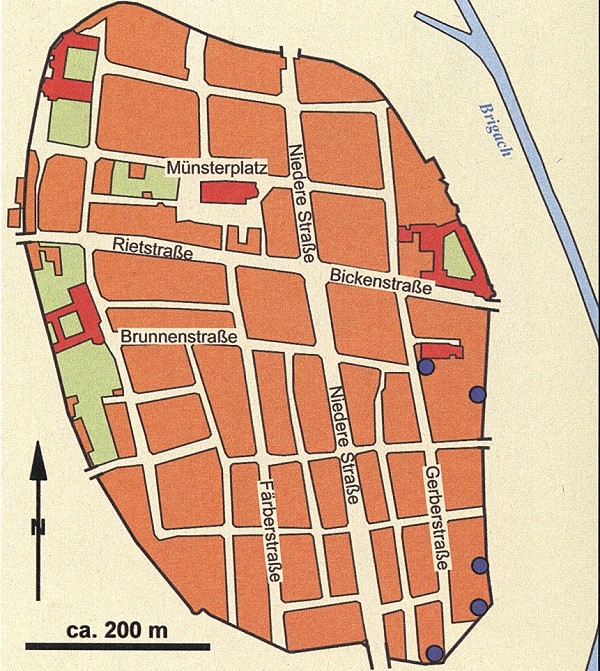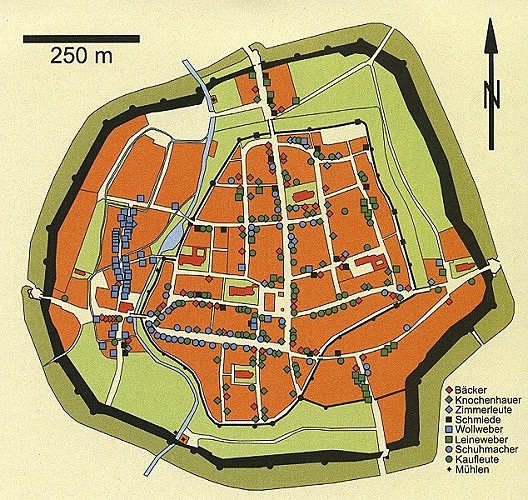Wir bei Past Present Promotions interpretieren Geschichte. Neben einem umfangreichen Wissen über die Sachkultur der Vergangenheit liegt uns da die heimische Geschichte natürlich besonders am Herzen. Einer der wirklich wichtigen Vorgänge, dessen Folgen das Rheinland bis heute prägen, war der Limburger Erbfolgestreit.
Der letzte Limburger Herzog stirbt ohne männlichen Erben
Alles begann 1279. In diesem Jahr tat Herzog Walram IV. von Limburg und Niederlothringen seinen letzten Atemzug. Da er ohne männlichen Erben starb, fiel die Herrschaft an seine Tochter Irmgard. Sie erhielt das Herzogtum 1282 von König Rudolf von Habsburg zu Lehen. Als Frau konnte sie die Herrschaft jedoch nicht selbst ausüben. Daher wurde ihr Ehemann, Reinald I., Graf von Geldern, der neue Herzog von Limburg.
Graf Reinald von Geldern wird neuer Herzog von Limburg
Reinald von Geldern trug nicht zu Unrecht den Beinamen „der Streitbare“. Er hatte sich von König Rudolf zusichern lassen, dass er die Herrschaft über Limburg bis zu seinem Lebensende behalten solle. Das schloss auch den Fall ein, dass Irmgard vor ihm sterben sollte. Dieser Fall trat 1283 tatsächlich ein. Doch entgegen der königlichen Anordnung machten weitere Erbberechtigte ihre Ansprüche geltend. Da war zunächst Heinrich VI., Graf von Luxemburg. Er war der Enkel der Ermesindis vom Luxemburg, der zweiten Ehefrau Walrams III., des drittletzten Herzogs von Limburg. Mit ihm konnte sich Reinald zunächst noch verständigen.

Die Ansprüche des Grafen von Berg
Graf Adolf VI. von Berg beharrte jedoch auf seinem Anspruch. Schon einmal nämlich waren das Herzogtum Limburg und die Grafschaft Berg in einer Hand gewesen. Das kam so: 1225 fiel Engelbert, Graf von Berg und Kölner Erzbischof, einem Mordanschlag zum Opfer. Erbin der Grafschaft wurde seine Schwester Irmgard. Sie war die Großmutter der gleichnamigen Witwe Herzog Walrams IV. von Limburg.
Diese ältere Irmgard also war mit Heinrich IV. verheiratet, dem Sohn Herzog Walrams III. von Limburg. Heinrich wurde nach dem Tod seines Vaters 1226 Herzog von Limburg und Graf von Berg. Nach dem Tod Heinrichs 1246/47 wurde die Herrschaft unter seinen Söhnen wieder geteilt. Limburg fiel an Walram IV., Berg an Adolf V., den Vater Adolfs VI.
Der Grund für Adolf VI., auch gegen den Willen des Königs an seinen Ansprüchen im Limburger Erbfolgestreit festzuhalten, war nun nicht einfach nur Starrsinnigkeit. Vielmehr war die Lage des Limburger Herzogtums ausschlaggebend. Es beherrschte nämlich die wichtigsten Übergänge am Mittellauf der Maas. Eine dauerhafte Vereinigung von Geldern und Limburg konnte Adolf keinesfalls hinnehmen. Die aber wäre bei einem genügend langen Leben des Grafen von Geldern durchaus möglich gewesen.
Die Rolle des Kölner Erzbischofs im Limburger Erbfolgestreit
Eine erneute Vereinigung des Herzogtums Limburg mit der Grafschaft Berg wiederum lag nicht im Interesse Siegfrieds von Westerburg. Der war zu dieser Zeit Erzbischof von Köln. Eine vereinigte Herrschaft Limburg-Berg hätte nämlich zu einer Umklammerung des Kölner Erzstifts geführt. Zudem war seit 1180 der Kölner Erzbischof Herzog nicht nur über die Rheinlande, sondern auch über Westfalen.
Eines der Ziele erzbischöflicher Politik war es nun, beide Gebiete zu einem geschlossenen Territorium zu vereinen. Dummerweise lag aber nicht nur das Gebiet der Grafschaft von der Mark dazwischen, sondern eben auch die Grafschaft von Berg. Erzbischof Siegfried tat also das für ihn einzig logische: Er stellte sich im Streit um das Herzogtum Limburg an die Seiten Reinalds von Geldern.
Herzog Johann I. von Brabant tritt auf den Plan
In dieser Situation erkannte Adolf von Berg, dass er seinen Erbanspruch gegen die gebündelte Macht Reinalds von Geldern und des Kölner Erzbischofs nicht würde durchsetzen können. Er verkaufte daher – damals durchaus üblich – seine Ansprüche an Johann I., Herzog von Brabant. Dieser konnte das Herzogtum Limburg gut gebrauchen. Das grenzte nämlich in Teilen wiederum an Teile seines eigenen Herrschaftsgebietes.
Doch auch die Expansion Brabants widersprach der erzbischöflichen Politik. Es kam, wie es kommen musste: Am 22. September 1283 schlossen Erzbischof Siegfried von Westerburg und Graf Reinald von Geldern ein Bündnis gegen Herzog Johann von Brabant und Graf Adolf von Berg. Kurz darauf begannen die ersten offenen Feindseligkeiten zwischen Brabant und dem Kölner Erzstift im Limburger Erbfolgestreit. Man fing an, sich gegenseitig die Felder zu verwüsten und die Dörfer anzuzünden. Das traf allerdings vor allem genau die, die mit der Sache am wenigsten zu schaffen hatten: die Bauern nämlich. Aber genau von deren Abgaben und Frondiensten finanzierten sich ja auch die Herren. Auf seine perfide Art machte das also durchaus Sinn.
Weitere Bundesgenossen für Brabant
Im Laufe der weiterhin auf mehr oder weniger kleiner Flamme kochenden Auseinandersetzung machte sich Herzog Johann auf die Suche nach weiteren Bundesgenossen. Einen fand er im Grafen Eberhard von der Mark. Auch das Jülicher Grafenhaus wechselte im Frühjahr 1288 von der geldrisch- erzbischöflichen Seite ins brabantische Lager. Graf Walram von Jülich und der Kölner Erzbischof hatten ihre langjährigen Streitigkeiten sowieso erst vor kurzem beigelegt. Besonders fest war das Bündnis zwischen Jülich und dem Kölner Erzstift daher sowieso nicht gewesen.

Die Situation eskaliert
Im Jahr 1288 eskalierte nun die Situation. Im Februar/März fiel Herzog Johann in das kölnische Land ein. Links und rechts seines Weges ließ er nichts als Verheerung zurück. Fast wäre es bei Hochkirchen, zwischen Düren und Lechenich, zur Schlacht gekommen. Die Stellung dort war Herzog Johann aber nicht sicher genug.
Graf Reinald setzte das Wechselspiel der Mächtigen fort. Er erkannte, dass er seinerseits das Herzogtum Limburg nicht für seine Familie würde halten können. Er verkaufte daher auf Anraten des Kölner Erzbischofs im Mai 1288 seine Erbansprüche an den ja sowieso erbberechtigten Grafen Heinrich VI. von Luxemburg. Damit war plötzlich Graf Heinrich der Hauptgegner für Herzog Johann.
Dieser war gerade in Bonn damit beschäftigt, die erzbischöflichen Gärten zu verwüsten. Gerade in dieser Zeit beschlossen die Kölner Bürger, ihr im Juli 1287 geschlossenes Bündnis mit ihrem eigenen Erzbischof zu kündigen. Die Kölner entschieden sich, Herzog Johann die Tore ihrer Stadt zu öffnen. Eine erzbischöfliche Burg und Zollstelle bei Worringen, einige Kilometer rheinabwärts von Köln, war der Anlass für das Zerwürfnis. Doch schon lange hatten die Bürger Kölns mit den Erzbischöfen um die Macht in ihrer Stadt gerungen. Nun sollte auch für sie die Entscheidung kommen.
Treffen auf dem Schlachtfeld
Von Bonn aus zog Herzog Johann auf Bitten der Bürger Kölns und mit ihrer militärischen Unterstützung nach Worringen vor die Tore der dortigen Zollburg. Das „roevere nest“sollte zerstört werden. Mit Herzog Johann ritten der Graf von Jülich, der Graf von der Mark und der Graf von Berg und alle ihre Verbündeten und Vasallen. Doch Siegfried von Westerburg, Heinrich von Luxemburg und Reinald von Geldern waren schon da, ebenfalls mit allen Rittern, die sie aufbieten konnten. Am 5. Juni des Jahres 1288 kam es auf der Fühlinger Heide, südlich von Worringen, zu einer der größten Reiterschlachten auf deutschem Boden. Der Limburger Erbfolgestreit hatte seinen Höhepunkt erreicht.
Literatur
Schäfke, Werner (Hrsg.): Der Name der Freiheit 1288-1988. Aspekte Kölner Geschichte von Worringen bis heute. Köln 1988.